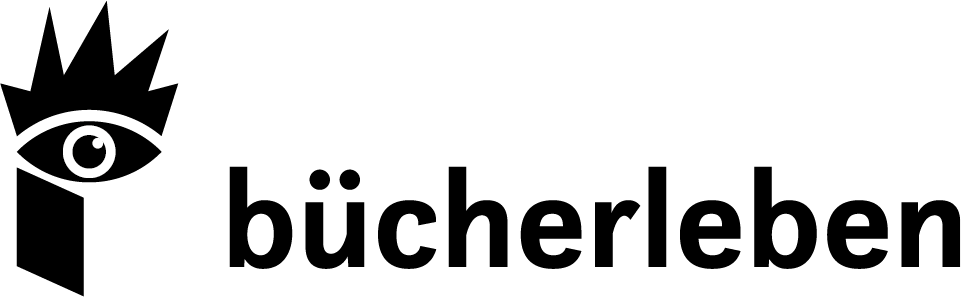Als Maria Stepanova Anfang 2023 in einem Interview mit der „Jüdischen Allgemeinen“ gefragt wurde, was der Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung für sie bedeute, hob sie zuerst auf den durchaus nicht alltäglichen Umstand ab, dass die Auszeichnung erstmals für einen Gedichtband verliehen wird. Für die Autorin ein Zeichen dafür, dass Lyrik zählt: „In dunkler Zeit könnte sie sogar wichtiger und notwendiger sein als sonst. In der anderen ‚dunklen’ Zeit, der Zeit der Konzentrationslager in Europa, haben Gedichte vielen Menschen geholfen zu überleben. Wir wissen aus unterschiedlichen Erinnerungen, sowohl aus der Sowjetunion als auch aus Nazi-Deutschland: Wenn jemand genug Gedichte auswendig konnte, schuf das eine Art Schutzraum, und der Mensch konnte nicht nur als Person überleben, sondern auch den Raum der Poesie mit anderen teilen – einen Raum, der sich zu einer Art großem Zelt aufblies und eine Gruppe von Menschen darunter vereinte, die in psychischer Hinsicht überleben konnten.“ In gewöhnlichen Zeiten, so die Autorin, sei das nicht so essenziell, aber das, was jetzt passiert, ändere alles. Und sie, die Dichterin – ist sie selbst in Zeiten des Krieges dazu in der Lage, Poesie zu verfassen? „Ich schreibe Gedichte, aber es kommt mir seltsam vor“, bekannte sie in einem Radio-Interview. „Es wirkt auf mich selbst, als ob ich doch schweigen würde.“ Mit der russischen Sprache umzugehen, die heute mit Hass und Gewalt aufgeladen sei, ist für Stepanova eine große Herausforderung. Im März 2022 gehörte sie mit Vladimir Sorokin, Swetlana Alexijewitsch, Ljudmila Ulitzkaja und vielen anderen zu den Unterzeichnern eines Appells russischsprachiger Schriftsteller, innerhalb Russlands die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu verbreiten. „Als Lyrikerin in dunklen Zeiten arbeite ich wie eine Minenentschärferin. Ich grabe die Sprache aus und säubere sie, versuche, ihr eine neue Existenz zu geben.“
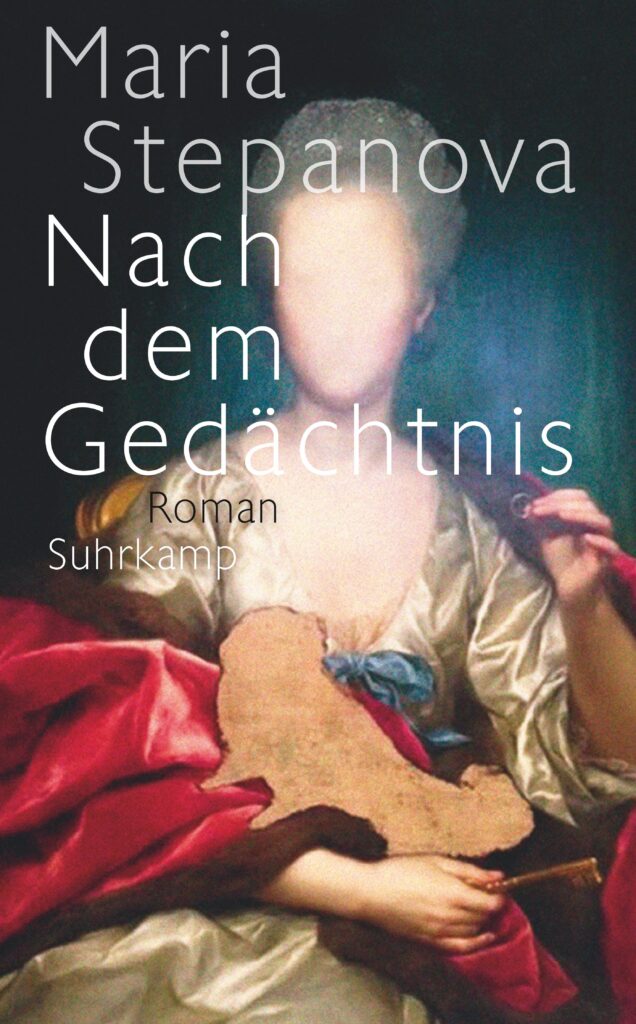
Bekannt geworden ist Maria Stepanova hierzulande zunächst als Romanautorin. Der Verlag annoncierte „Nach dem Gedächtnis“ (2018), die deutsche Übersetzung des ein Jahr zuvor im russischen Original erschienenen Buchs „Pamjati pamjati“ sogar als „Metaroman“ – tatsächlich hat Stepanova eine bestechende Form von Literatur erfunden, collagiert aus autobiografischer Erzählung, biografischer Forschung und kulturwissenschaftlichem Essay. Dazwischen spannt sie Lebenswelten auf wie ein riesiges Gemälde, mit perfekt ausgemalten Details einerseits und andererseits beschädigten, manchmal unlesbaren Stellen: „Ein diachrones Wimmelbild, das dem individuellen Schicksal einen übergreifenden Kontext gibt.“ (Barbara Villiger Heilig, Republik) Maria Stepanova hat ihr Buchprojekt mehr als 30 Jahre mit sich herumgetragen. Zunächst war es der Versuch, die Geschichte ihrer jüdisch-russischen Familienmitglieder zu bergen. „Kurios war dabei, dass meine Großmütter und -väter einen beträchtlichen Teil ihrer Energie darauf verwendet hatten, unsichtbar zu bleiben. Möglichst unauffällig zu werden, im häuslichen Dunkel unterzutauchen, sich abseits zu halten von der Weltgeschichte mit ihren überlebensgroßen Narrativen und ihrer Fehlertoleranz von ein paar Millionen Menschenleben.“ Stepanovas Roman ist da das genaue Gegenteil: Ihre assoziative, mehrdimensionale Schreibweise bedeutet einen Akt des Widerstands gegen Erinnerungsverbote und kollektiven Gedächtnisverlust. Um vom Leben der weitverzweigten Familie, allesamt „Untermieter“ der Geschichte wie ihre Urgroßmutter Sarra Ginsburg, erzählen zu können, erschafft Maria Stepanova einen Gedächtnisraum, in dem die Stimmen einer ganzen Epoche widerhallen und Dinge des privaten Lebens zu Exponaten eines Geistermuseums werden. „Hinfahren und nachsehen“, so formuliert es die Autorin einmal, das sei die ‚Grand tour’ einer neuen kollektiven Bewegung in ihrer Generation.
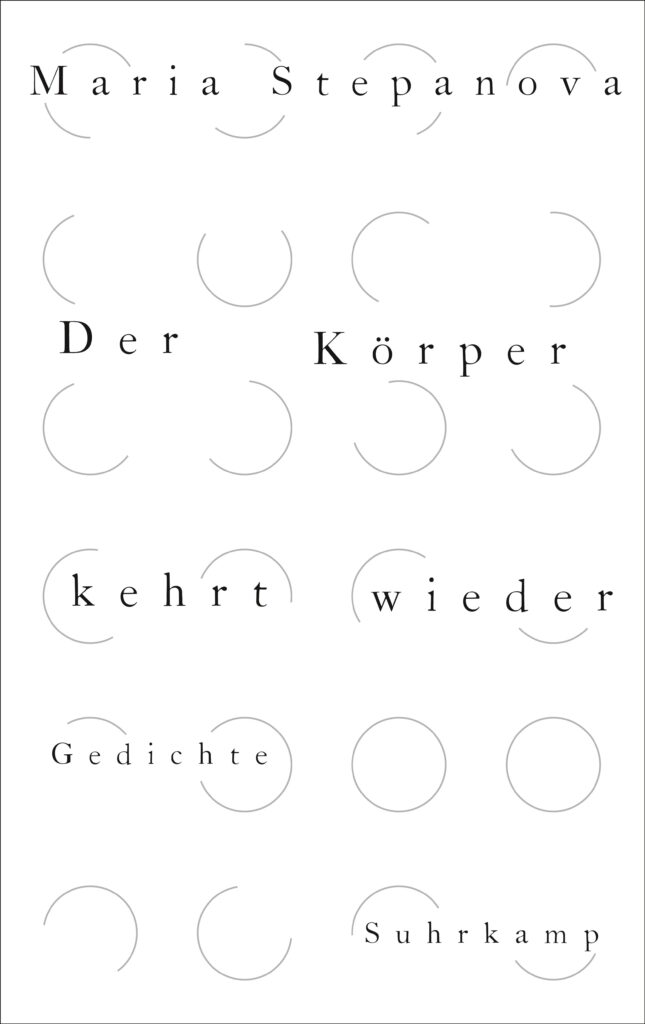
Eine berühmte Autorin war Maria Stepanova schon lange vor dem Erfolg ihres ersten Prosawerks. Seit mehr als zwanzig Jahren hat sie die weltoffene Literaturszene Moskaus mitgeprägt und sich als produktive, experimentierfreudige Lyrikerin auch im angelsächsischen Raum einen Namen gemacht. Die drei Langgedichte des Bandes „Der Körper kehrt wieder“ (2020) loten mit epischem Atem die kollektive Geschichte der Sowjetunion aus, um Vergessenes und Verdrängtes heraufzuholen und den Toten Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. „Stepanova betätigt sich ein weiteres Mal als poetische Archäologin: Sie legt Verschüttetes frei, besichtigt Trümmer, setzt zusammen, was das verheerende 20. Jahrhundert auf seinen Schlachtfeldern hinterlassen hat, in der Hoffnung auf Wiederkehr des Unwiederbringlichen. Ein großes, geradezu utopisches Projekt, das die Autorin mit unbändiger Sprachkraft und unter Aufbietung ihrer immensen Belesenheit ins Werk setzt“, lobt Ilma Rakusa in der Neuen Zürcher Zeitung. Ein weiteres Mal schmiegt sich die Autorin an die Sprechweisen und Rhythmen anderer Dichterinnen und Dichter an – oder zitiert sie ironisch. Das Spektrum reicht von Puschkin und Alexander Blok über Goethe und Ezra Pound bis zu Inger Christensen. Dort, wo die 2009 gestorbene dänische Ausnahmedichterin in „Alphabet“ (1988) die Erschaffung der Welt in Sprache evoziert, beschwört Stepanova im titelgebenden Langgedicht „Der Körper kehrt wieder“ in einer Art Gegenbewegung die Reparatur der aus den Fugen geratenen Welt. Besonders beeindruckend mit seinem Feuerwerk an Metaphern, Neologismen und Wortspielen ist der dritte Zyklus des Bandes, „Krieg der Tiere und Untiere“, der bereits 2015 entstand – und mit visionären Sprachbildern auf die seit 2014 im Donbas tobenden Kämpfe reagiert. Im Gedicht unterläuft Stepanova jede Forderung nach Eindeutigkeit, lässt jeden Versuch der Machtausübung durch Sprache ins Absurde kippen: „es gibt keinen unterschied zwischen / erstem und zweitem / vaterländischem und vaterländischem / großem und stillem / atlantischem / globalem // so oder so fallen sie / alle im selben im einzigen bruder-, bürger- / wo das morgenrot aus der asche // speerspitzen klaubt“. Das blutige Schlachten wird als etwas sichtbar, das direkt am Körper ansetzt: „wie im frühjahr in wehrkommissionen / schlüsselbeine betastet werden und rücken / die stämmigen drahtigen haarigen werden genommen / ärztinnen prüfen und nicken“.
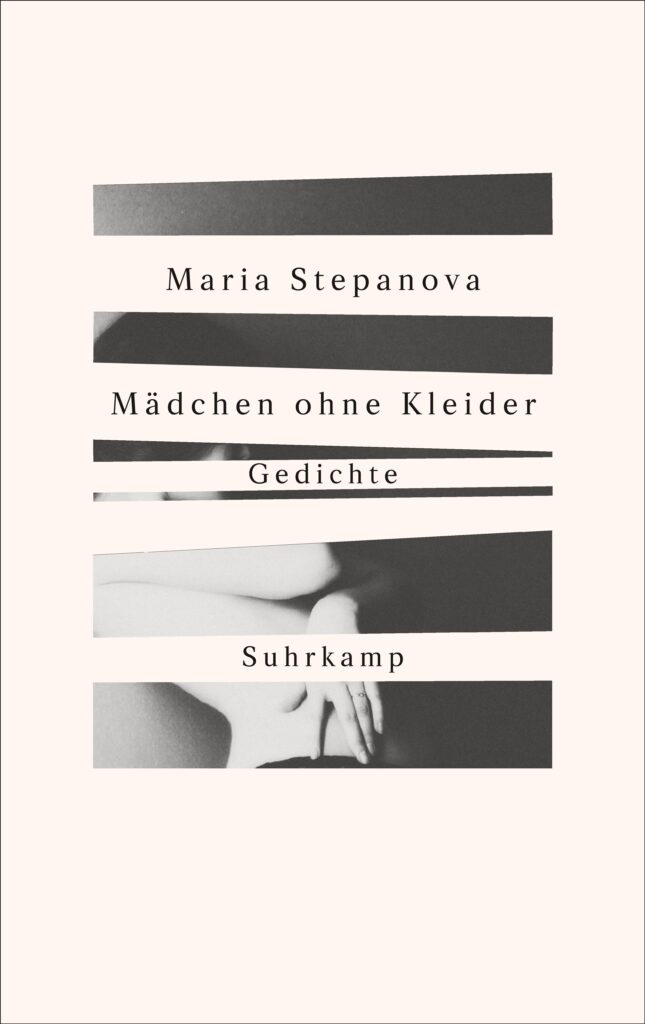
In ihrem nun ausgezeichneten, erneut aus drei Zyklen bestehenden Gedichtband „Mädchen ohne Kleider“ (2022) setzt Maria Stepanova die „Reparatur des Lebens“ mit Mitteln der Poesie fort. Wobei ein weiteres Mal gilt, was die Autorin einmal mit Blick auf Ossip Mandelstam geschrieben hat: Dass das Gedicht „schwankend am Rand eines Abgrunds“ stehe, „zwischen Hoffnung und Urteil, Hinrichtung und Rettung“. Im titelgebenden ersten Zyklus ist das zufällig gefundene Foto einer nackten jungen Frau Anlass, die Kolonisierung des weiblichen Körpers als unendliche Geschichte männlicher Raubzüge darzustellen. Stepanova ruft die gängigen Metaphern und Topoi auf, die mit dem männlichen Blick auf den Körper verbunden sind – zugleich eine nur allzu oft geübte Praxis politischer und militärischer Gewalt. Auf die Zehnzeiler von „Mädchen ohne Kleider“ folgt mit „Kleider ohne uns“ ein sogenannter Sonettenkranz, der sich als poetisches Gegenstück zur Darstellung in Dienst genommener Frauenkörper entpuppt – eine Art Kulturgeschichte der Bekleidung, in der die Sterblichkeit des menschlichen Körpers evoziert wird. Für den im letzten Jahr verstorbenen Literaturkritiker Michael Braun bilden die drei Zyklen des Bandes „absolute Höhepunkte im aktuellen Stimmenkonzert der Weltpoesie“.

Der Ausbruch der Covid-Pandemie setzte im März 2020 einem Aufenthalt Maria Stepanovas im englischen Cambridge ein Ende. Zurück in Russland, verbrachte sie die folgenden Monate in einem Zustand der Erstarrung: Es ist die Zeit der Zerschlagung der belarussischen Protestbewegung wie der russischen Zivilgesellschaft, die Zeit scheint eingefroren. „Heute“, sagt Maria Stepanova in einem Gespräch mit ihrer Übersetzerin Olga Radetzkaja, „erscheint mir die Einsamkeit, die Sorge, der Schrecken, die ich damals empfand, wie eine Art Ouvertüre – ein Prolog zu dem, was gegenwärtig in Europa geschieht.“ Das „Winterpoem 20/21“ (2023), das in seinem Originaltitel „Swjastschennaja sima“ auf ein patriotisches Kriegslied anspielt, das nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion populär war, spricht vom Winter und vom Krieg, von Verbannung und Exil, von sozialer Isolation und existenzieller Verlassenheit. Erneut verwebt Stepanova Dichter-Stimmen, die zu ihr sprechen, in einen polyphonen Chor: Von Ovid, dem Hausgott der Verbannten, in Ungnade gefallenen, auf den sich bereits Puschkin, Brodsky oder Mandelstam beriefen, bis zu chinesischen Versen und dänischen Märchen. Heute liest Maria Stepanova das „Winterpoem 20/21“ mit anderen Augen – der Krieg hat den Blick, mit dem sie auf eigene und fremde Texte schaut, verändert. Vieles im „Winterpoem“ ist plötzlich viel näher und konkreter als zum Zeitpunkt des Schreibens. Aber stärker ist noch ein anderes Moment: „Das Gefühl, dass wir… in einer plötzlich zäh gewordenen historischen Zeit feststecken und erst langsam, dann immer schneller rückwärts rutschen, zurück in die Vergangenheit, in archaische, statische Schichten, wo jedes Wort in der Luft gefriert.“ Ein Jahr nach Beginn des Überfalls auf die Ukraine, der eben nicht rückstandslos in der Formel von ‚Putins Angriffskrieg’ aufgeht, stellt Stepanova in einem Essay für die F.A.Z. schmerzhafte Fragen: Der opferreiche Sieg gegen den Aggressor im Zweiten Weltkrieg, in Schulbüchern und Heldenbiografien tausendfach erzählt, war die einzige Erinnerung, die die Menschen in Russland wirklich verband. Nun ist das Land selbst zum brutalen Angreifer geworden, und alle seine Bürger gehören unabänderlich zur Gemeinschaft jener, die das getan haben. „Zu diesem wir zu gehören, ist qualvoll“, schreibt Maria Stepanova, „aber vielleicht ist es das Einzige, was derzeit Sinn hat: Das getane Böse muss ausgeglichen und der Ort, von dem es ausging, wieder bewohnbar gemacht werden, die Sprache, die es spricht, muss sich verändern. Vielleicht wird das Stigma, das schmerzhafte Zeichen der kollektiven Mittäterschaft eines Tages zu dem Punkt, an dem der Weg von einem blinden ‚Wir’ zu einer Gesellschaft der sehenden ‚Ichs’ beginnt. Bewerkstelligen lässt sich das nur von innen.“ Die vielstimmige Beschwörung der gefrorenen und langsam wieder auftauenden Zeit wäre ein Anfang.
Zur Person:
Maria Stepanova, geboren am 9. Juni 1972 in Moskau, studierte am Maxim-Gorki-Literaturinstitut in Moskau. Von 2007 bis 2012 leitete sie die Internet-Zeitschrift OpenSpace.ru; darüber hinaus ist sie Mitgründerin und Redakteurin der über das aktuelle kulturelle Leben in Russland kritisch informierenden Internetplattform colta.ru. 2018/19 hatte sie die Siegfried-Unseld-Gastprofessur an der Humboldt-Universität zu Berlin inne. Derzeit lebt und arbeitet sie als Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Sie ist Autorin von mehr als einem Dutzend Lyrik- und Essaysammlungen sowie Trägerin mehrerer russischer und internationaler Literaturpreise, darunter der prestigeträchtige Andrej-Belyj-Preis und das Joseph Brodsky Foundation Fellowship. Für ihren Roman „Nach dem Gedächtnis“, der bislang in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde, erhielt sie 2018 in Russland den Bolschaja-Kniga-Preis sowie 2020 in Deutschland, zusammen mit ihrer Übersetzerin Olga Radetzkaja, den Brücke Berlin Preis.