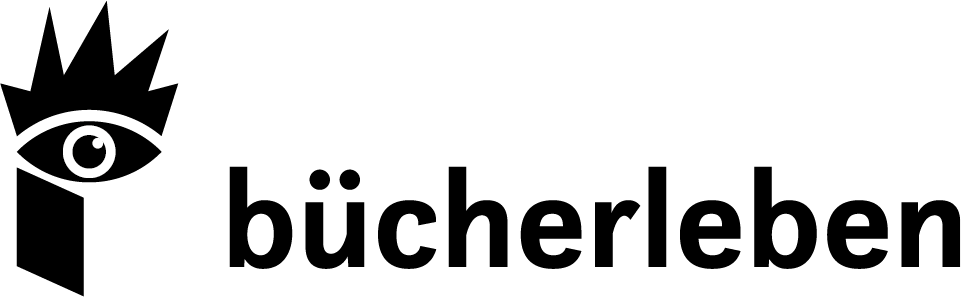Das kleine Kaffee am Rand des Prenzlauer Bergs ist gut gefüllt; der schmale jungen Mann mit Brille, der hinter einem Milchkaffee in sein Notebook tippt, könnte als Student durchgehen, der an seiner Hausarbeit schreibt. Doch Ron Segal, der Autor und Filmemacher, sitzt wieder einmal auf gepackten Koffern. Seine deutsche Freundin studiert in London; in wenigen Tagen fliegt er zu seiner Familie nach Tel Aviv. Seit 2009 lebt Segal, mit Unterbrechungen, in Berlin. Ein DAAD-Stipendium ermöglichte ihm die Recherche im Shoah Foundation Institute für Visual History an der Freien Universität, in dem 52.000 Interviews mit Holocaust-Überlebenden aus mehr als 50 Ländern aufbewahrt werden. Aus unzähligen dieser Puzzleteile erstand Adam Schumacher, der Held von Segals erstem Roman „Jeder Tag wie heute“: Ein 90jähriger Schriftsteller, der nach Jahrzehnten der Verweigerung wieder nach Deutschland reist, um seine Erinnerungen aufzuschreiben – im Wettlauf mit einer ausbrechenden Alzheimer-Erkrankung. Ron Segal hat große Pläne: Aus seinem Debütroman soll ein abendfüllender Animationsfilm werden. Im Herbst 2015, hofft er, kann die Produktion beginnen. Segal weiß, dass er ein Marathon-Projekt vor der Brust hat: „Das wird ein langer Prozess. Viel länger, als ein Buch zu schreiben.“
Was bringt einen jungen, lebenslustigen Israeli von knapp 30 Jahren dazu, sich mit dem Holocaust zu beschäftigen – noch dazu in Berlin?
Ron Segal: Ich fand immer, dass alles, was ich über dieses Thema wusste, bereits vor mir gedacht und gesagt wurde. Ich wollte etwas eigenes sagen – und konnte das nicht. Ich musste recherchieren. Dazu kommt die Geschichte meiner Großeltern. Sie lebten in Berlin und schafften es, rechtzeitig zu fliehen. Sie waren beide sehr jung; meine Oma kam mit 16 Jahren nach Israel. An Berlin hatten sie eigentlich gute Erin-nerungen, wollten jedoch nie zurück. Als ihr Mann 70 wurde, haben die beiden Deutschland noch einmal besucht. Das Tagebuch, das Großmutter damals geführt hat, hat sie mir vorgelesen. Das fand ich sehr spannend: Eine Mischung aus Hass und Liebe…
Als Sie das erste Mal in Deutschland waren, haben Sie die Schuhe Ihres Opas getragen?
Segal: Stimmt. Es waren sehr schöne Schuhe, vermutlich in Deutschland gearbeitet. Ich habe es gemocht, hier mit ihnen zu laufen, eine interessante Erfahrung. Die Idee, der Hauptfigur meines Romans den Namen „Schumacher“ zu geben, kam mir allerdings beim Lesen eines Märchens der Gebrüder Grimm. Sie kennen es bestimmt: Der Schuster, dessen Schuhe nachts von fleißigen Wichtelmännchen besohlt werden… Ich dachte: Was, wenn wir an Stelle des Schuhmachers einen Schriftsteller hätten? Und statt der Schuhe Erinnerungen – oder Geschichte?
Wie kann Literatur mit dem Holocaust umgehen, wenn ihr nur noch die Fiktion oder die Erinnerung aus zweiter, dritter Hand bleibt?
Segal: Sie schafft eine persönliche Verbindung zu den Lesern. Es ist beispielsweise sehr schwierig, eine Gedenkstätte zu besuchen – und tatsächlich etwas zu fühlen. Man weiß natürlich, wie man sich respektvoll verhält, was man spüren müsste. Aber das passiert nicht immer. Die Situation ist ein bisschen künstlich. Mit einer guten Geschichte ist der Leser gleichsam in den Schuhen der Figuren unterwegs.
Sie nähern sich Ihrem ernsten Thema sehr leicht, mitunter mit schwarzem Humor. In Deutschland taucht da reflexartig die Frage auf: Darf man das?
Segal: Das geschieht auch in Israel. Doch wenn sich nur die Generation der Holocaust-Überlebenden zu Wort melden darf, wäre die Geschichte auserzählt. Erinnerungen muss man immer wieder neu erfinden. Ich versuche, eine zweite oder sogar dritte Ebene der Erinnerung zu bauen. Eine Interpretation von authen-tischer Erfahrung. Das darf Literatur! Kunst, die etwas nicht darf, ist für mich nicht interessant.
Sie haben für Ihr Buch 18 Monate im Visual History Archive des Shoah Foundation Institute an der FU Berlin recherchiert. Eine einschneidende Erfahrung?
Segal: Zugegeben, ich hatte Angst davor. Aber es war einfacher, als ich dachte. Vielleicht hat sich das auch auf die Stimmung des Buches ausgewirkt. In den Videos begegneten mir Männer und Frauen, die oft mit viel Humor über ihre schlimmen Erfahrungen sprechen. Auch bitterem Humor. Manchmal musste ich sogar laut lachen, was die Archivare natürlich geschockt hat. Viele der Zeitzeugen sind tatsächlich gute Geschichten-Erzähler! Und genau die habe ich gesucht.
Momentan arbeiten Sie daran, einen Animationsfilm zu Ihrem Roman fertigzustellen. Wieso gerade dieses Genre?
Segal: Warum soll ein Klavierspieler nicht Trompete spielen? (lacht) Animation erscheint mir sinnvoll, gerade bei diesem heiklen Gegenstand: Dokumentar-filme benutzen Archivmaterial, für Spielfilme werden Locations und Geschehnisse nachgebaut. Ich würde mich dort verlieren, das ist nicht meine Welt. In der Animation kann ich mich auf die persönliche Geschichte hinter der erdrückenden Erzählung vom Holocaust konzentrieren.
Sehen Sie sich in Israel mit Blasphemie-Vorwürfen konfrontiert? Oder ist so etwas spätestens seit Art Spiegelmans „Maus“ kein Thema mehr?
Segal: Filme wie „Persepolis“ oder „Waltz with Bashir“ haben gezeigt, dass sich das Genre auf seriöse Weise zeitgeschichtlichen Themen annähern kann. Wir sind also nicht die ersten, die so etwas tun. Die Japaner machen es schon seit vielen Jahren: Es gibt Animee-Filme über Hiroshima und Nagasaki. Anne Frank ist Heldin in einem Dutzend Animee-Streifen! Für uns, die wir es gewohnt sind, Pixar- und Disney-Filme zu schauen, mag es etwas Neues sein.
Sie leben abwechselnd in Berlin und Tel Aviv. Was haben beide Städte gemeinsam?
Segal: Die kosmopolitische Stimmung der Städte ist durchaus vergleichbar. Auch, dass man viel Fahrrad fährt. Und inzwischen gibt es hier in Berlin so viele Israelis, dass es mir manchmal tatsächlich wie ein zweites Tel Aviv vorkommt. Beide Städte sind ziemlich groß, trotzdem findet man in seinem Kietz alles, was man zum Leben braucht.
Wie funktioniert das Zusammenleben mit Palästinensern, Libanesen, Syrern in dieser Stadt? Geht man sich eher aus dem Weg – oder aufeinander zu?
Segal: Wir sind weit entfernt von den Konfliktzonen des Nahen Ostens. Wahrscheinlich können wir hier deshalb besser miteinander reden. Wir müssen zumindest nicht streiten.
Berlin als gelobtes Land?
Segal: Ich habe im Rahmen meines Stipendiums gerade zwei Monate in Moabit gelebt, wo es 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Ich wohnte in einer Art Künstler-Kommune, dem Zentrum für Kunst & Urbanistik. Auch hier gab es ein paar Leute aus dem Iran – wir haben uns sehr gut angefreundet. Ich habe viel Arabisch auf der Straße gehört, Türkisch, ein wahres Sprachgemisch – es funktioniert irgendwie!
Der Nahostkonflikt ist jedoch auch hier Thema, als junger Israeli können Sie dem nicht ausweichen. Eine Bürde?
Segal: Ich glaube, kein Schriftsteller möchte auf die Rolle eines Posterboys für die israelische Politik reduziert werden. Ich bin Autor – kein Politiker. Ich verstehe die Neugier, ich schätze sie auch. Es ist gut, Fragen zu stellen. Das bedeutet ja, dass man sich auf den anderen einlässt.
Manchmal würden Sie lieber nur über Filme, Musik oder Literatur reden?
Segal: Literatur und Politik lassen sich nicht trennen. Man kann auch kluge politische Fragen stellen. Dann bekommt man die richtigen Antworten.
Ron Segals erster Roman „Jeder Tag wie heute“ ist 2014 im Wallstein Verlag erschienen.
Bildquelle: Tobias Bohm