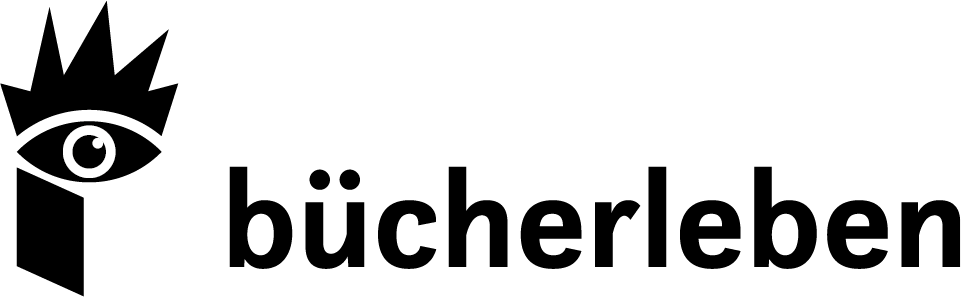Jedes Jahr dasselbe: Man rast auf Weihnachten und die Zeit „zwischen den Jahren“ zu und hofft auf freies, voraussetzungsloses Lese-Glück. Ein Glück, das auch Jury-Mitgliedern von Literaturpreisen zuteil wird?
Marie Schmidt: Wir haben von der Buchmesse einen Reader bekommen, auf dem alle 486 Einreichungen für den Preis der Leipziger Buchmesse gespeichert sind. Mit dem sitze ich schon seit geraumer Zeit auf dem Sofa. Das ist aber kein Lesen, wie man es sich für ruhige Tage erträumt.
Sie haben – vom Wilhelm-Raabe- bis zum Döblin-Preis – bereits in allerhand Jurys gesessen und wissen, dass Jury-Arbeit vor allem eins ist: Arbeit. Warum setzt man sich dem aus?
Es gibt sonst kaum einen Ort, an dem so konzentriert über Texte gesprochen wird wie in der Jury-Sitzung eines Literaturpreises.
Marie Schmidt
Schmidt: Es gibt sonst kaum einen Ort, an dem so konzentriert über Texte gesprochen wird wie in der Jury-Sitzung eines Literaturpreises. Beim Döblin-Preis, der ja für noch unveröffentlichte Buchprojekte vergeben wird, war ich sehr berührt: Man bekommt dort einen sehr intimen Einblick in entstehende Bücher. Im Job bei der Tageszeitung denke ich in anderen Formen von Relevanz als bei der Juryarbeit; es sind ganz unterschiedliche Umgehensweisen mit Büchern, an denen man wächst.
Wir haben keinen Mangel an Literaturpreisen – was ist für Sie das Besondere am Preis der Leipziger Buchmesse?
Schmidt: Das ist die Auffächerung in drei Kategorien, insbesondere die tolle Kategorie Übersetzung. Ein Bereich, der in der großen Öffentlichkeit zumeist unterbelichtet bleibt. Mit der Frage, was eine sehr gute Übersetzung wirklich ausmacht, hatte auch ich mich, so ins Detail gehend, seit meinem Studium nicht mehr befasst. Das ist schon jetzt ein Gewinn.
Wie organisiert sich die Jury-Arbeit?
Schmidt: Wir haben uns in einer Zoom-Konferenz gesehen, einige Kolleginnen auch schon im Real Life. Es gibt sehr viele E-Mails, die die ganze Zeit über hin und her gehen.
Aber es liest nicht jeder alles?
Schmidt: Nein. Die Titel sind unter den Jurorinnen und Juroren aufgeteilt. Sobald es jedoch zu einzelnen Büchern Zustimmung gibt, fangen auch die Kolleginnen und Kollegen an zu lesen.
Sie steigen dann auch für Ihre Favoriten in den Ring?
Schmidt: Das kommt, aber vermutlich eher später im Prozess. Wenn die Liste kürzer geworden ist.
Im Herbst wurde, etwa von Ludwig Lohmann vom Kanon Verlag, der auch als Literatur-Podcaster unterwegs ist, bemängelt, dass auf den Shortlists der wichtigen Literaturpreise Bücher aus unabhängigen Verlagen fehlen. Eine berechtigte Kritik?
Schmidt: Das erlebe ich als Berichterstatterin, ehrlich gesagt, nicht so…
Der Preis der Leipziger Buchmesse scheint sich die Jacke tatsächlich nicht anziehen zu müssen: In der Kategorie Belletristik ging er zuletzt an Mikrotext (2023), Droschl (2022 und 2021) und die Verbrecher (2019).
Schmidt: Anders als bei den Preisen haben es Indie-Verlage in den Feuilletons schwerer. Das hat mit Dynamiken der Öffentlichkeit zu tun: Das, was scheinbar groß und wichtig ist, wird auch groß und wichtig in der Zeitung dargestellt. So wird ein neuer Roman von Stuckrad-Barre…
… am Erscheinungstag groß besprochen…
Schmidt: Aufmerksamkeit, die dann womöglich fehlt für eine Entdeckung aus dem Verbrecher Verlag.
Sie würden aber keine Indie-Quote fordern?
Schmidt: Ich glaube, das ist illusorisch. Wenn es um ästhetische Urteile geht, sollte man es der Sensibilität der Jurorinnen und Juroren überlassen, darauf zu achten, dass auch weniger „laute“ Positionen gehört werden. Das schaffen wir schon!
Identitäts- und Genderfragen werden im Literaturbetrieb gerade breit diskutiert. Welche Rolle spielen außerliterarische Überlegungen in der Jury-Arbeit?
Schmidt: Es glaubt immer niemand, aber: In den Jurys, in denen ich bisher saß, spielten sie in erstaunlichem Ausmaß KEINE Rolle. Und sollte jemand mal, ich beispielsweise, in einer drohenden Patt-Situation, angeregt haben, nach äußeren Kriterien zu gehen, bin ich sehr zurechtgewiesen worden. Allerdings gibt es eben auch Literaturen, die in den Jahrzehnten zuvor vielleicht nicht so ernst genommen wurden; Bücher von Frauen beispielsweise oder Bücher von Menschen mit Diskriminierungserfahrung – die vielleicht auch ästhetisch interessanter sind als andere Bücher. Ihnen ist eine Signatur unserer Epoche eingeschrieben – über gebrochene Lebensläufe vielleicht oder, speziell in Deutschland, die Frage nach der mehr oder weniger gelungenen Vereinigung. Das sind die Fragen unserer Zeit…
Sie waren im Frühjahr Critic-in-Residence in St. Louis. Das klingt, wenn nicht nach dem Kritikerinnen-Himmel, so doch spannend?
Schmidt: Es ist eine tolle Einladung. Aber St. Louis ist nicht das Paradies. Die Aufgabe besteht darin, dort zu unterrichten. Das Germanistik-Department der Washington University St. Louis hat seit den 1980er Jahren ein Programm, innerhalb dessen sie jedes Jahr eine Kritikerin und eine Dichterin einladen, Protagonisten der Gegenwartsliteratur, wenn man so will. Ich habe einen Kurs angeboten zu Literatur, in der Sprachwechsel eine Rolle spielt, Arbeitstitel „Einwanderungsbedingungen in die deutsche Sprache und Literatur“. Da spielten die Gewinner des Preises der Leipziger Buchmesse 2022 eine wichtige Rolle – Uljana Wolfs Etymologischer Gossip (Kookbooks) in der Kategorie Sachbuch/Essayistik, und Tomer Gardis Roman Eine runde Sache (Droschl) in der Belletristik-Kategorie.
Für Sie auch Gelegenheit, sich mit den Voraussetzungen und „Begleitumständen“ Ihres Kritikerinnen-Jobs auseinanderzusetzen?
Schmidt: Ich wollte eigentlich mit den Studierenden über die Bücher reden, sie hatten allerdings ganz andere Fragen. Es gibt dort auch ein Creative-Writing-Programm, bei dem man seinen PhD zur Hälfte mit einem Roman-Projekt erlangen kann. Infolgedessen waren die Studierenden sehr heiß darauf zu wissen, wie eben solche Preise funktionieren und wer sie bekommt.
In meinen Kritiken findet sich meist nicht dieser eineindeutige Satz: Dieses Buch ist toll. Oder jenes ist schlecht, das können Sie sich sparen.
Marie Schmidt
Und was, bitte, macht eine gute Literaturkritik aus?
Schmidt: Oha. Große Frage. Eine gute Kritik stellt ein Buch – egal, ob Belletristik oder Sachbuch – erst mal seinen eigenen Prinzipien gemäß dar. Was will es, was versucht es? Dann stellt es diesen Versuch in einen Kontext. Wie steht es, seinen eigenen Maßstäben folgend, in der Welt? Dadurch ergibt sich ein Urteil fast wie von selbst. Zumindest können die Leserinnen und Leser entscheiden, ob sie sich mit dem Gegenstand der Kritik auseinandersetzen wollen. In meinen Kritiken findet sich meist nicht dieser eineindeutige Satz: Dieses Buch ist toll. Oder jenes ist schlecht, das können Sie sich sparen. Dafür werde ich durchaus auch kritisiert. Um der Bücher willen möchte ich so nicht sprechen. Die letzte Entscheidung sollten die Leserin, der Leser in der Buchhandlung treffen.
Die Marketing- und Werbeabteilungen der Verlage lieben diese „blurbs“…
Schmidt: Ehrlich gesagt, versuche ich sogar so zu schreiben, dass diese zitierbaren Halbsätze nicht in meinen Texten enthalten sind. Manchmal klappt es nicht, Zeitungen leben nun mal von Zuspitzungen.
Manchmal wirkt aber auch der Hammersatz: Als Sie in der SZ schrieben, dass Mascha Jacobs’ „Dear Reader“ der aktuell beste Literatur-Podcast im Land sei, musste ich den sofort anhören.
Schmidt: Erwischt, Regel gebrochen. Aber auch, weil sich die Podcast-Welt derzeit drastisch umstellt. Es war lange eine Medien-Welt, in der sehr viel passieren konnte, auch Experimentelles. Nun sortiert sich auch das nach ökonomischen Maßstäben der Reichweite und des Anzeigenpotenzials neu. Ein Podcast wie Dear Reader, der ganz anders funktioniert als gewöhnliches Literaturfernsehen, hat es da sehr schwer. Diese Fallhöhe musste man einmal markieren.
Sie haben mal gesagt, dass die „kulinarische Kritik“ auf dem Vormarsch wäre. Sie meinen da keine Kochbücher, oder?
Schmidt: Oft wird das eigene Wohlgefühl bei der Lektüre als Kriterium herangezogen.
„Ich habe das gern gelesen…“ – So?
Schmidt: Das ist natürlich ein phatischer Satz; damit möchte man eher ausdrücken, dass man das Buch überhaupt gelesen hat – und eher dafür ist. Zum Glück finden wir Kritiker dann meist noch einen zweiten, dritten und vierten Satz (lacht).
Jetzt untertreiben sie, denn 2019 haben Sie den Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik bekommen und sind damit ein Stück weit in den Kritiker-Olymp vorgerückt. Können Sie sich noch an Ihre Anfänge erinnern? Gab es einen Plan?
Schmidt: Nein. Ich habe eine Ausbildung an der Journalistenschule absolviert zur Redakteurin und Journalistin. Ich hatte zwar bereits als Kind in einem Lehrerhaushalt immer mit Büchern zu tun gehabt und dann Komparatistik, also Vergleichende Literaturwissenschaften, studiert – hätte mich aber nie zu sagen getraut: Ich werde Literaturkritikerin.
Es ist Ihnen passiert…
Schmidt: Bei der „Zeit“, für die ich dann frei arbeitete, gab es Leute, die mir manchmal kommentarlos Bücher zugeschickt – und mich haben schreiben lassen. Irgendwann, als ich mal etwas Bescheidenes über das Literaturkritikerin-Werden gesagt habe, meinte ein Kollege: Das bist Du schon! Und ich dachte: Ah. Ich würde heute auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen immer sagen: Es ist eine Frage der Praxis. Man macht’s – oder man macht’s nicht. Es ist ja nicht so, dass es zu viele gute Literaturkritiker gäbe! Es kann auch ein zäher Beruf sein. Oft lese ich nicht nur das zu rezensierende Werk, sondern ziehe in der Bibliothek noch ein Zweit- oder Drittbuch zu Rate. Das ist eine lange, einsame Geschichte.
Als Freier ist man auch finanziell nicht auf Rosen gebettet…
Schmidt: Stimmt. Auf Zeile bei einer Tageszeitung zu schreiben, macht man nicht, um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen.
In der Laudatio zum Kerr-Preis sagte Ihre Kollegin Susanne Mayer über Sie: „Sie schreibt weniger für die Kollegen, sie schreibt auch nicht, um der Welt mitzuteilen, wie wichtig sie ist, sie schreibt über Dinge, die sie interessieren. Das sind vielleicht Bücher, die andere noch gar nicht auf dem Schirm haben.“
Schmidt: Das ist sehr freundlich. Das stimmte natürlich mehr in meinen ersten Berufsjahren, wo es arriviertere Kritikerinnen und Kritiker gab, die die Bücher besprachen, auf die alle warteten. Und ich habe am Rande auch Dinge entdecken können, die etwa in Deutschland noch nicht so bekannt waren, die ich aus einem amerikanischen oder französischen Kontext kannte. Das einbringen zu können, ist ein wenig das Privileg der Anfänger, die sich einen Weg erst noch bahnen. Das war eine schöne Zeit. Inzwischen besteht die Erwartung, dass ich als Literaturredakteurin auch „große“ Bücher bespreche.
Wir sind in den Wochen der Empfehlungslisten, deshalb möchte ich sie zum Schluss fragen: Welchem Buch aus dem zurückliegenden Jahr wünschen Sie möglichst viele Leserinnen und Leser?
Schmidt: Da gibt es einige. Aber Dana Vowinckel und ihrem in Chicago, Jerusalem und Berlinspielenden Roman Gewässer im Ziplock (Suhrkamp) wünsche ich sie besonders; vor allem jetzt, nach dem 7. Oktober, wo vieles im Buch noch einmal einen ganz anderen Bedeutungsraum entwickelt. In den SZ-Literaturtipps zu Weihnachten habe ich die erste Werkausgabe von Marlen Haushofer (Claassen) empfohlen. Die meisten kennen vermutlich „Die Wand“, aber es gibt darüber hinaus eine ganze Reihe von Romanen und Erzählungen, die uns heute unglaublich aktuell und modern anmuten.
Marie Schmidt wurde 1983 in München geboren, studierte im Hauptfach Vergleichende Literaturwissenschaften sowie Europäische Ethnologie und Interkulturelle Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach der Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule München und einer abgebrochenen Promotionsarbeit über Ezra Pound arbeitete sie als Redakteurin vier Jahre bei der „Zeit“ in Hamburg. Seit Juli 2018 ist sie Literaturredakteurin bei der „Süddeutschen Zeitung“. Im Frühjahr 2023 war sie Critic-in-Residence an der Washington University in St. Louis. Juryerfahrung sammelte sie bereits beim Wilhelm Raabe-Literaturpreis, Alfred-Döblin-Preis und Marie Luise Kaschnitz-Preis. Gemeinsam mit David Hugendick von der „Zeit“ gehört Marie Schmidt nun erstmals der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse an.